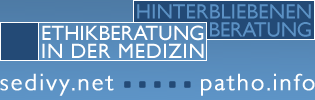Fallbeispiele
Fallbeispiele (Link zur Universität Göttingen)
-
Zum Problem ausreichender Gründe für eine Behandlungsbegrenzung (Ethik in der Medizin 2/2006)
-
Probleme einer Palliativbetreuung am Lebensende (Ethik in der Medizin 4/2005)
-
Sondenernährung und Patientenwille (Ethik in der Medizin 3/2004)
-
"Sollen wir noch operieren? - Müssen wir noch operieren?" (Ethik in der Medizin 2/2004)
-
Therapieabbruch auf der Intensivstation (Ethik in der Medizin 3/2002)
-
Zur Problematik des mutmaßlichen Willens am Lebensende (Ethik in der Medizin 1/2002)
-
Nicht verhungern, nicht verdursten – zum Problem der Sondenernährung (Ethik in der Medizin 4/2001)
-
Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen? (Ethik in der Medizin 2/1999)
Organtransplantation
Bei der Organtransplantation gibt es einerseits die Entnahme von Organen eines Lebenden zwecks Organspende, wie zum Beispiel einer Niere. Dies ist zulässig, weil der Spender der Entnahme davor natürlich explizit zustimmen muss.Bei einem Verstorbenen könnte in diesem Punkt rasch ein ethischer Konflikt entstehen.
Nach österreichischem Recht ist es zulässig, einem Leichnam Organe zu entnehmen, wenn dadurch ein anderes Leben gerettet oder die Gesundheit eines Anderen wiederhergestellt werden kann. Allerdings hat jeder das Recht diese Prozedur zu verhindern, indem er sich ins Widerspruchsregister des Staates Österreich einträgt.
Patientenverfügung
In der Patientenverfügung weist der Patient an, an welchen Werten sich die Ärzte orientieren sollen, wenn er nicht mehr kommunikationsfähig ist. Weiters kann angegeben werden, welche Behandlungen durchzuführen und welche zu unterlassen sind. Auch Vertrauenspersonen können vermerkt werden, die anstelle des Patienten Entscheidungen über weiteres Vorgehen treffen, ist der Patient unfähig für sich selbst zu entscheiden.Seit 1. Juni 2006 gibt es in Österreich ein neues Patientenverfügungsgesetz.
Unterschieden wird hier zwischen einer "verbindlichen", die nach ärztlicher Beratung von Anwalt oder Notar unterzeichnet wird und 5 Jahre gültig ist, und einer "beachtlichen" Patientenverfügung, die Ärzten als Orientierung dienen soll.
Des weiteren wird vermerkt, was "Sterben in Würde" für den Patienten bedeutet. Der Mediziner hat sich daran zu orientieren.
Sterbehilfe
Sterbehilfe bezeichnet Handlungen, die das Leben eines Sterbenden oder schwerstkranken Patienten in seinem Willen beenden. Man unterscheidet grob drei Formen der Sterbehilfe:- Aktive Sterbehilfe: Der Arzt führt durch eine Überdosis von Schmerzmitteln den Tod herbei oder ist dem Patienten beim Suizid behilflich. In einigen Ländern erlaubt, ist die aktive Sterbehilfe in Österreich strafrechtlich verboten und wird rechtlich durch die Paragraphen Mord (§ 75 StGB), Tötung auf Verlangen (§ 77 StGB) und Mitwirkung am Selbstmord (§ 78 StGB) abgedeckt und mit Freiheitsstrafe geahndet.
- Passive Sterbehilfe: Es werden keine lebensverlängerten Maßnahmen durchgeführt. Rechtfertigung bietet hier eine mögliche Patientenverfügung des Patienten.
- Indirekte Sterbehilfe: Es werden Medikamente zur Linderung von Beschwerden verabreicht, die allerdings die Lebenserwartung verkürzen. Anwendung findet sie in der Palliativmedizin.
(Universität Göttingen)
Vertretungs Netz
Institut für Ethik und Recht in der Medizin der Universität Wien
Martin Amerbauer, Erste Schritte in der Philosophie: Einheit 6: Angewandte Ethik